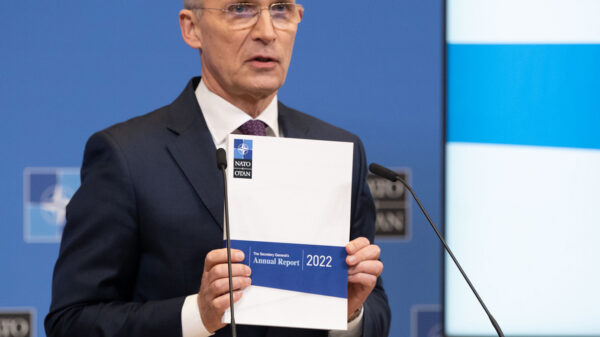In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen 19 bewaffnete russische Shahed Drohnen (Aktualisierung am 12.11.2025: Mittlerweile wird von einem gemischten Schwarm von bewaffneten Shahed und reinen Decoy-Drohnen ausgegangen) in den polnischen Luftraum ein. Aufgrund der Flugroute und der Tiefe, in der die Drohnen nach Polen eindrangen, kann es weder Zufall noch ein unkontrollierter Anflug gewesen sein, wurde Defence Network durch eine gut informierte Quelle aus der Bundeswehr bestätigt. Russland wollte testen, wie gut die NATO-Fähigkeiten zur Drohnenabwehr sind. Schließlich ist Russland mittlerweile in der Lage diese Systeme zu Tausenden zu produzieren, pro Monat werden teilweise über 6.000 Shahed gegen die Ukraine geschickt.
Polen war nicht unvorbereitet, es hatte in den vergangenen Monaten massiv in seine Grenzen investiert. Und doch konnten die Drohnen weit in das polnische Territorium eindringen. Die Bild-Zeitung schreibt von 265 Kilometern, eine Zahl, die Defence Network von der Quelle aus der Bundeswehr bestätigt wurde. Dies entspricht in etwa der Strecke Berlin-Hannover. Allein diese Distanz zeigt, dass es zum einen kein Zufall gewesen sein kann und zum anderen, dass die Drohnenabwehr an der Ostflanke deutlich reformiert werden muss.
Zudem waren die NATO-Streitkräfte nur in der Lage, drei der Shahed Drohnen überhaupt abzuschießen. Und mussten hierfür ihre Kampfflugzeuge F-16 und F-35 bemühen. Das Fazit des russischen Tests kann also nur lauten: Durchgefallen.
Sensoren zur Erkennung
Vor jeder Drohnenabwehr steht die Erkennung. Es müssen also genügend Sensoren vorhanden sein die in der Lage sind, die Gefahr zu identifizieren und zu verfolgen. Beim gestrigen Vorfall waren auch deutsche Patriot-Radare, die sich aktuell zum Schutz der Ostflanke und der Ukraine-Umschlagplätze in Polen befinden, an der Erkennung und Verfolgung beteiligt. Doch dies sind punktuelle Fähigkeiten, die nur in einem größeren Sensorverbund bestehen können.
Die Niederlande, deren F-35 zum Abschuss der Shahed über Polen beitrugen, haben noch gestern verkündet, dass sie eigene niederländische Satellitenkapazitäten entwickeln wollen. „Bislang nutzten die Streitkräfte Technologien, die von anderen bereitgestellt wurden“, berichtet das niederländische Verteidigungsministerium. „Durch die Entwicklung eines eigenen Informationssystems werden die Streitkraft unabhängiger.“
Vernetzung der Systeme
Der nächste wichtige Schritt ist die Vernetzung der Systeme, um die durch die Sensoren gewonnen Informationen weiterzuleiten. Was sich trivial anhört ist bereits das erste große Hemmnis, an dem viele NATO-Streitkräfte – inklusive der Bundeswehr – scheitern.
Die Ukraine realisiert die Vernetzung ihrer Luftverteidigung fast ausschließlich über Starlink, womit ein einzelner Mensch in den USA aktuell tatsächlich die Macht über Millionen Menschenleben in der Hand hält. Doch ohne Starlink ließen sich selbst die deutschen Vorzeigeluftverteidigungssysteme IRIS-T SL nicht umfassend und in ihrer vollständigen Effizienz nutzen.
Um die Anhängigkeit zu verringern startete die Ukraine allerdings bereits mit Unterstützung aus Schweden die Produktion eigener Terminals für ein eigenes Satelliteninternet, um eine eigenständige, sichere Kommunikationsinfrastruktur aufzubauen.
Deutschland hat nichts Vergleichbares. Andere Nationen haben bereits eigene Verträge für Starlink abgeschlossen. Die US-Streitkräfte wollen wiederum Konstellationen mit hunderten von Satelliten in den kommenden Jahren ins All schießen, um dort sowohl die sichere Kommunikation und Datenverbindung als auch weitere Fähigkeiten zu generieren. Dabei setzen die USA neben dem bekannten Link 16 auch auf Laserkommunikation, um den immer größer werdenden Bedarf an Bandbreite abbilden zu können. Das Projekt ist Teil der Proliferated Warfighter Space Architecture (PWFSA).
Scheitern bei der Drohnenabwehr
Was zudem fast als Desaster bezeichnet werden muss sind die Fähigkeiten zur Drohnenabwehr. 19 Shahed drangen in den polnischen Luftraum ein, nur drei konnten abgeschossen werden. Eine Quote, die jeden tatsächlich kriegerischen Angriff zur Katastrophe werden ließe. Zudem mussten Kampfflugzeuge mit ihren Lenkflugkörpern die russischen Drohnen vom Himmel holen, wobei ein Lenkflugkörper um die 400.000 Dollar kostet, der Einsatz des Flugzeugs noch nicht mitgerechnet, während die Produktion einer Shahed bei unter 100.000 Euro liegt. Die Kosten für Drohnen aus eigener Produktion könnten für Russland sogar noch deutlich günstiger sein, verschiedene Quellen sprechen vor nur 20.000 Euro pro System.
Abgesehen davon, dass die Abwehr von Drohnen durch bewaffnete Flugzeuge eine unbalancierte Kosten-Nutzen-Rechnung wäre, bliebe auch das Problem der Produktion. Russland kann aktuell deutlich mehr Drohnen produzieren als Europa Lenkflugkörper, um diese Drohnen abzuschießen.
Systeme zum Abfangen der Shahed
Die Ukraine zeigt, wie es besser geht. Sie hat mittlerweile mehrere Methoden zur Abwehr von Shahed Drohnen entwickelt, die nicht nur eine deutlich höhere Erfolgsquote haben als der NATO-Einsatz, sondern auch wesentlich kostengünstiger sind.
Israel kann ebenfalls einige Erfahrungen und daraus entstandenen Abwehrsysteme gegen Shahed bieten und deren Industrie hätte entsprechende Produkte im Angebot.
Doch auch Deutschland muss sich nicht verstecken. Obwohl die Bundeswehr entsprechende Systeme noch nicht beschaffte, hat die Industrie einige Lösungen, teilweise gemeinsam mit den ukrainischen Streitkräften, entwickelt und produziert.
Ende August führte das deutsche Unternehmen Donaustahl beispielsweise Tests eines neuen Mehrzweck-Gefechtskopfs zur Drohnenabwehr durch, den es selbst als Shahed-Killer bezeichnet. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben hierfür einen neuen Sprengkopf entwickelt, der speziell zur Bekämpfung von Shahed-Drohnen gedacht ist. Erfolgreiche Tests bei IABG sollen eine „Todeszone“ von 50 Metern zeigen.
Diehl Defence, das Mutterhaus von IRIS-T SL, hat wiederum die CICADA in der Entwicklung. Mit zwei Gefechtsköpfen, einmal Splitter gegen Drohnenschwärme und Netz gegen Einzeldrohnen, soll sie eine flexible, einsatzstarke und kostengünstige Möglichkeit zur Drohnenabwehr bieten.
Dies sind nur zwei Beispiele die zeigen, dass die deutsche Industrie bereits reagiert hat, nur aktuell noch die Beschaffung durch die Streitkräfte fehlt.
Die Fähigkeitslücke besteht allerdings nicht nur bei den Effektoren, sondern auch bei den Sensoren und den Mitteln zur Vernetzung. Denn wenn nur drei von 19 eindringenden russischen Drohnen, so die offiziellen Zahlen der polnischen Regierung, überhaupt abgefangen werden und einzelne Drohnen bis zu 265 km in polnisches Hoheitsgebiet eindringen konnten, dann kann das Fazit nur lauten: Test nicht bestanden, durchgefallen.
Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!
Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: