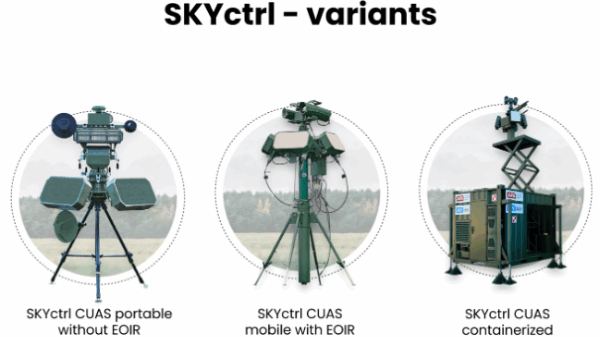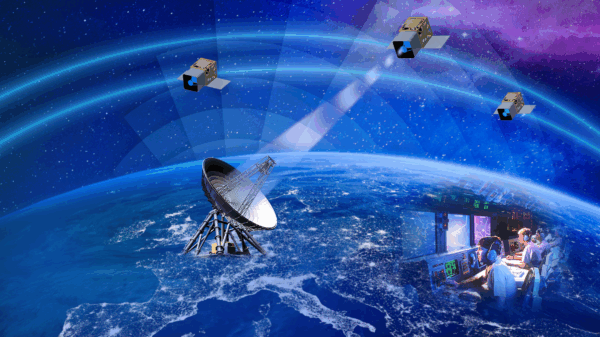Der israelische Spezialist Skana Robotics (Stand N11-100) entwickelt unbemannte maritime Plattformen, die praktische operative Erkenntnisse mit fortschrittlicher Technik verbinden. Das Unternehmen ist auf skalierbare, softwaredefinierte Systeme spezialisiert, die auf Autonomie, Belastbarkeit und Integration in Hybridflotten – auf und unter Wasser – ausgelegt sind. Mit seinem offenen Architekturansatz, seiner Simulationsumgebung und den proprietären Systemen SeaSphere und Vera ermöglicht Skana modernen Marinen, den Einsatz, die Verwaltung und die Aufrechterhaltung ihrer Seemacht um unbemannte bzw. autonome Fahrzeuge zu erweitern und neu zu überdenken.
Anlässlich der DSEI UK 2025 zeigt das Unternehmen zwei seiner drei Plattformen, das taktische Autonomous Surface Vessel (ASV) Bull Shark sowie das Autonomous Underwater Vessel (AUV) Stingray. Beide verfügen über softwaredefinierte, missionsadaptive Fähigkeiten für den Einsatz über und unter Wasser, und können im System untereinander und mit bemannten Plattformen agieren. Diese beiden werden bisher durch das Autonomous Amphibious Vessel (AAV) Alligator kompletiert.
Skana Robotics wurde durch israelische Veteranen der Marine-Spezialeinheiten (ISR Seal Team 6) zusammen mit Robotik-Experten gegründet. Daher stehen diese Plattformen für einen Wandel hin zu softwaredefinierten, skalierbaren und operativ flexiblen Marineeinheiten, die für den Einsatz mit bemannten und unbemannten Systemen in verteilten maritimen Operationen entwickelt wurden.
Mit bereits gesicherten Erstaufträgen tritt Skana nun in die nächste Phase der Skalierung des Einsatzes mit operativen Partnern weltweit ein. Die neuen Plattformen wurden mit Fokus auf Massenproduktion, Flexibilität und Integration nach NATO-Standard entwickelt und sind darauf ausgelegt, die Präsenz der Marine zu erweitern und gleichzeitig den logistischen Aufwand und die Kosten zu minimieren. Alle Skana-Systeme sind so konzipiert, dass sie sich durch Code weiterentwickeln lassen und eine nahtlose Interoperabilität mit bestehenden Flotten und verbündeten Systemen ermöglichen.
Laut Anbieter soll die Produktionsmethodik von Skana traditionelle Hindernisse für die Expansion der Marine beseitigen und es verbündeten Nationen ermöglichen, Tausende von autonomen Schiffen einzusetzen, ohne auf Werften oder umständliche Herstellungsprozesse angewiesen zu sein, die die Effektivität der Mission beeinträchtigen. Dieser Ansatz definiert neu, wie maritime Resilienz in großem Maßstab erreicht werden kann und wie eine wirklich autarke Streitkräftestruktur aussieht.
Daher hat Skana Robotics ein einheitliches System für maritime Resilienz entwickelt, das datengesteuert, skalierbar, anpassungsfähig und für softwaredefinierte Schiffe ausgelegt ist. Nach Meinung von Skana reichen Lösungen auf Wasseroberflächenebene nicht aus, der maritime Bereich erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der in 3D gedacht werden muss.
System wie ein Netzwerk
Das Herzstück und operative Gehirn der unbemannten Flotte von Skana ist SeaSphere, die Engine von Skana für die Ressourcenzuweisung und Missionsplanung. Es handelt sich um ein zentralisiertes System, das autonome Missionen für die gesamte Flotte plant, konfiguriert und koordiniert. Es definiert übergeordnete Ziele, weist Rollen zu und legt autonome Verhaltensweisen für jedes Schiff fest – und sorgt so für strategische Kohäsion und systemweite Anpassungsfähigkeit. Von der Planung vor der Mission bis hin zu Anpassungen während der Mission steuert SeaSphere die Ausführungslogik in großem Maßstab.
Ergänzt wird SeaSphere durch Vera, eine proprietäre ROS2-basierte Ebene für die Missionsausführung und -überwachung. Vera übersetzt flottenweite Anweisungen in lokalisierte autonome Aktionen und passt sich in Echtzeit an Umweltveränderungen an. Diese Architektur ermöglicht verteilte Befehle, die Zusammenarbeit zwischen unbemannten Systemen und die Echtzeit-Zusammenarbeit mit bemannten Plattformen.
Vera ist der programmierbare Befehlskern, der in jedem Skana-Schiff eingebettet ist und für die Ausführung und Überwachung der Missionslogik an Bord verantwortlich ist. Sein hardwareunabhängiges Design und die integrierte Ausfallsicherung gewährleisten eine sichere Missionsresilienz unter realen Bedingungen.
Vera bietet eine offene Architektur und lässt so die Integration von Sensoren, Effektoren oder anderer Plattformen einfach und schnell zu. Neben Vera gibt es noch den Bereich der Simulation. Diese analysiert die Mission und sorgt für die Effektivität durch Planung und Anpassung der Plattformen in Abhängigkeit der Missionsplanung.
„Der maritime Bereich erfordert Autonomie, die Komplexität überstehen, sich sofort anpassen und ohne Kompromisse funktionieren kann“, sagte Idan Levy, Mitbegründer und CEO von Skana Robotics. „Wir machen fortschrittliche autonome Fähigkeiten zugänglich und skalierbar und ermöglichen so einen breiten Einsatz und Synergien zwischen den Systemen. Unser Ökosystem aus Schiffen und Technologien unterstützt den Echtzeit-Datenaustausch, die modulare Neukonfiguration sowie vollständig autonome und ferngesteuerte Missionen und bietet Marinen eine unübertroffene operative Ausfallsicherheit, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität.“
Insgesamt ist das System sehr anpassungsfähig und „data driven“. SeaSphere vernetzt alle Systeme zu einem wahren Netzwerk und übernimmt bzw. passt die Missionsplanung an. So agieren die Fahrzeuge nicht nur wie ein Schwarm, sondern ein flexibles Netzwerk, eine geletitete Flotte. Und es betrachtet das gesamte Umwelt, unter und über Wasser, mit einem einheitlichen Blick. Bei Bedarf sogar inklusive der luftgestützten UAVs.
Die eingesetzte Künstliche Intelligenz (KI) passt die Umsetzung der Mission nach den Phasen und auftretenden Änderungen nach an. Laut Hersteller ist das System sehr einfach in der Nutzung und in der Anpassung nach den Nutzerbedürfnissen. So kann der Nutzer den Grad der Autonomie anpassen bzw. vorgeben. Nur bei Bedarf oder rechtlichen Vorgaben ist im Extremfall der Autonomie noch ein Man-in-the-loop notwendig. Das System kann laut den Concept of Operations (CONOPS; Betriebskonzept) angepasst werden.
Fahrzeuge von Skana Robotics
Der Bull Shark ist ein taktisches ASV, das für verschiedene Missionen wie ISR-Aufklärung und Bekämpfung entwickelt wurde. Es verfügt über ein skalierbares Design, eine Nutzlastkapazität von bis zu 150 kg und fungiert als Kommunikationsknotenpunkt zur Koordination mehrerer ober- und unterirdischer Ressourcen.
Eine taktische, kooperationsfähige Oberflächenplattform, die für ISR-, Abfang- und Schnelloffensivsmissionen entwickelt wurde. Der Bullshark kann von Docks, Stränden oder größeren Schiffen aus gestartet werden und verwandelt die Oberflächenkriegsführung von statisch zu dynamisch.
Das Fahrzeug ist agil, modular und für schnellen Einsatz konzipiert. Es kann autonom oder ferngesteuert eingesetzt werden, mit fortschrittlichen Funktionen für Verfolgung, Verweilen und offensiven Operationen. Der Bull Shark ist für die Integration von Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) entsprechend den Kundenanforderungen konzipiert, um den Aufklärungs- oder Bekämpfungsbereich – letzteres durch Loitering Munition – noch zu vergrößern. Der Hersteller gibt die maximale Geschwindigkeit mit 50 kn und die Reichweite mit 120 Seemeilen an.
Der Stingray ist ein loitering AUV, das für ISR-Aufklärung, Anti-Submarine Warfare (ASW) und den Schutz von Infrastruktur in komplexen Unterwassergebieten entwickelt wurde. Es unterstützt autonome Unterwassernavigation, Verankerung am Meeresboden, einen lautlosen Standby- und Reaktivierungsmodus.
Es bietet eine standardmäßige Batterielebensdauer von 24 Stunden, die durch ein Batteriemodul verlängert werden kann, und kann je nach Kundenwunsch von einer speziellen Unterwasser-Dockingstation und jeder Plattform (U-Booten, Patrouillenbooten oder anderen Skana- oder Marinefahrzeugen) aus gestartet werden. Je nach Einsatzart kann das Fahrzeug auch bis zu 72 Stunden operieren, so der Hersteller.
Diese stationäre Tiefseeplattform kann sich auch am Meeresboden auf die Lauer legen und nur bei Bedarf reagieren. Von der lautlosen Aufklärung bis hin zu kinetischen Einsätzen passt sich Stingray in Echtzeit an. Es wurde entwickelt für den dauerhaften Einsatz in komplexem Unterwasserterrain, und nimmt modulare Nutzlasten wie Sonar, ELINT, offensiven Operationen, Kartierung und Infrastrukturschutz auf.
Das System kann auch unter Wasser auf- bzw. nachgeladen werden, auch eine Bodenverankerung und autonome Navigation sind möglich, so der Hersteller. Der Hersteller gibt die Einsatztiefe mit bis zu 300 Metern an, die Reichweite mit 45 Seemeilen, die maximale Geschwindigkeit mit 12 Kn sowie die Nutzlast mit 15 kg. Stingray kann unter Wasser auch auf einer Stelle hovern, um Stellen genauer zu untersuchen, zudem ist es sehr mobil.
Das dritte Fahrzeug im Bund ist das autonome Amphibienfahrzeug Alligator. Es ist eine Plattform für den Transport zwischen See und Land, die Logistik, Sensoren oder Personal mit Tarnung und Anpassungsfähigkeit bereitstellt. Es ermöglicht den nahtlosen Übergang zwischen Wasser und Land, und kann modular zur Überwachung, Lieferung, Evakuierung oder Kommunikation eingesetzt werden. Laut Hersteller hat das Fahrzeug eine extrem geringe akustische/thermische Signatur um auch für verdeckte Missionen eingesetzt werden zu können. Es kann in seichten Gewässern, Sümpfen, Flussufern und umkämpften Gebieten eingesetzt werden.
Und es integriert sich in Echtzeit mit ASVs, AUVs und Überwasserschiffen. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 8 km/h bzw. 40 Kn, die Reichweite bei 300 Seemeilen und die Nutzlast bei 1.500 kg. Der Alligator kann zudem den Stingray weit herausbringen und absetzen, um dessen Reichweite noch einmal zu verlängern. Um amphibisch operieren zu können verfügt die Plattform über einfahrbare Kettenantriebe.
Alle Fahrzeuge haben eine skalierbare und modulare Auslegung. Daher können sie schnell angepasst werden. Auch in der Größe für längere Stehzeiten oder mehr Nutzlast.
Der Ansatz des Herstellers ist einfach, eine Produktion reicht nicht aus, da sie keine Resilienz schafft. Eine nachhaltige Lösung erfordert eine technologische Grundlage, die Flexibilität und Vielseitigkeit ermöglicht. Von Anfang an wurde der „design to cost“- sowie „design to mass production“-Ansatz verfolgt. Dieses hat man aus der Ukraine gelernt. Auch ist der Technologietransfer ein fester Ansatz in Planung und Umsetzung.
Skana Robotics geht fest davon aus, dass sie Nutzerstaaten die Produktion im eigenen Land haben wollen. Daher soll auch alles simpel mit der Fähigkeit zur Massenproduktion gehalten werden, inklusive schneller Anpassbarkeit nach neuen Fähigkeitsforderungen. UAVs sollen in Zukunft ebenfalls überall integrierbar sein, als vorausfliegendes Auge.
Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!
Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: